Warum weniger Kram mehr Raum für Gedanken lässt (und warum wir trotzdem die Muscheln von Dänemark behalten)
Es gibt zwei Sorten Menschen: Die einen (also mich), die am Samstagmorgen um acht mit missionarischem Eifer und Staubsauger bewaffnet durchs Wohnzimmer marschieren – der Blick: entschlossen, das Outfit: Funktionskleidung, die Musik: »Eye of the Tiger«. Sie (also ich) reißen die Fenster auf, lassen frische Luft herein, während der Rest der Familie unter der Decke hofft, das Drama möge vorbeiziehen wie ein kurzer Sturm aus Essigreiniger und Motivation.
Und dann gibt es die anderen. Die einfach das Licht ausmachen, wenn das Chaos zu schlimm wird. »Wenn ich’s nicht sehe, existiert’s nicht« – das ist keine Nachlässigkeit, das ist mentale Gesundheit.
Und ganz ehrlich? Beide haben recht. Ordnung kann befreiend wirken, manchmal fühlt sie sich an wie ein frisch gewaschenes, perfekt gefaltetes T-Shirt. Aber manchmal ist das Chaos auch einfach… charaktervoll. (Oder, wie man es sich schönredet: „kreative Energie in physischer Form“.)
Männer, Frauen und das große Missverständnis namens Ordnung
Wenn es ums Aufräumen geht, leben Männer und Frauen oft in parallelen Welten.
Beim Göttergatten sieht es in der Werkstatt meist aus wie geleckt. Da gibt’s Extra-Boxen für jede Schraubengröße, eine Wand, an der jedes Werkzeug, dass dort hängen darf, per Umriss eingezeichnet ist. Kein Gegenstand liegt zufällig irgendwo herum. Der Göttergatte weiß genau, wo alles ist: Der 13er-Schlüssel hängt beim 12er, die Makita-Aufladegeräte liegen ordentlich in einer Reihe, und der rollbare Werkzeugkasten steht artig an der daneben – obendrauf thront der Schweißhelm, darüber ist akkurat die Rolle mit den Putztüchern angebracht – wie’s sich gehört.
Ebenso aufgeräumt geht es in den Arbeitshosen zu. Diese Hosen verfügen über mehr Taschen als ein Trecking-Rucksack für eine Himalaya-Expedition. Jedes Tool hat seinen festen Stammplatz: Zollstock (alias Flaschenöffner), geladenes (immer 100% vor Arbeitsbeginn!) Handy, funktionierender Kugelschreiber, scharfes Taschenmesser für die Silofolie, Taschenlampe (mit der man mühelos ein Fußballstadion ausleuchten könnte) und eine Mac-Gyver-Allzweckzange.
Und ja, die vergessenen Kronkorken, die später in der Waschmaschine auftauchen, stammen vermutlich vom Feierabendbier mit dem Nachbarn. Das ist keine Nachlässigkeit – das ist Tradition.
Im Haushalt hingegen endet die militärische Disziplin abrupt. Da steht der gleiche Mann plötzlich orientierungslos vor dem Kühlschrank und sucht die Butter, als wäre sie ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Und wenn er die Küchenschere nicht sieht, dann ist sie weg – auch wenn sie, wie immer, in der oberen Schublade links. (Seit 2006 unverändert.)

Frauen (also ich) hingegen haben ein ganz eigenes System. Eins, das für Außenstehende aussieht wie Zufall, aber in Wahrheit der Ordnung einer höheren Macht folgt. Die Küche: blitzblank, fast schon heilig. Doch wehe, man öffnet die Kramschublade. Dort findet man ein Paralleluniversum aus Dingen, die keiner erklären kann:
Zwei Teelichter, eine Armbanduhr, Impfpass von Buddy, Ibuprofen, Kugelschreiber, Notizblöcke (beides Werbegeschenke von Engelbert Strauss und vom örtlichen Landhandel), Lippenpflegestifte, Lesebrille, Pfefferspray, mein analoger Wochenkalender (Küchenoutlook) und selbstverständlich Haarbänder und Zahnseidensticks auf Kurzwahl.
Ordnung ist Ansichtssache.
Der Kopf ist so voll wie die Kommode
Man sagt ja, ein unaufgeräumtes Zimmer ist ein Spiegel des Geistes. Wenn das stimmt, dann war mein Kopf vor einiger Zeit eine Mischung aus Rumpelkammer, Altpapiercontainer und Wühltisch. Vor etwa einem Jahr habe ich mich schon mal mit dem Thema beschäftigt und inzwischen große Fortschritte gemacht 💪. In einem Regal habe ich unter einem Stapel Baselkarton Schulhefte mit der Aufschrift »Lena Steinkamp 8 b« gefunden. Weder das eine noch das andere wird hier weder gebraucht, geschweige denn vermisst. Seit ich angefangen habe, ein paar rigoros auszumisten und nicht nur in hübschere Boxen umzuschichten, ist auch im Kopf wieder Platz.

Weniger Zeug bedeutet weniger visuelle Geräusche. Und weniger visuelle Geräusche bedeuten mehr Raum für Gedanken. Klingt esoterisch? Ist aber einfach Neurobiologie mit Staublappen.
Warum Aufräumen schwerer ist, als man denkt
Das Problem ist nicht der Staub. Der lässt sich wegsaugen, wegwischen, wegignorieren. Das eigentliche Problem sind die Geschichten, die an den Dingen kleben – wie emotionale Preisschilder, die sich nicht ablösen lassen.
Die riesige, unfassbar hässliche Glasschüssel mit dem blauen/bunten Fuß von wem auch immer? (ich weiß genau, von wem, aber das bleibt mein Geheimnis). Sie passte nicht mal in die Öffnung des Glascontainers – also Restmüll. Die Keramik-Robbe des ersten Langeoog-Urlaubes? »Da hatten die Kinder noch Matschhosen an.« Die Buffalow-Cowboystiefel (echtes Leder, geflammt, schräger Absatz) »Von meinem ersten Job in der Würstchenbude beim Schützenfest«. Und dann das Piratenkostüm mit Hut und Augenklappe (für mich, nicht für die Kinder!): »Ach war das lustig damals beim Varler Karneval«. Gott sei Dank aus der Pre-Handy-Foto-Zeit!
Dinge sind Erinnerungsanker mal aus purem Gold, mal aus Polyester und schlechtem Geschmack. Wenn man sie wegräumt, hat man das Gefühl, man entsorgt ein Stück seiner Geschichte. Und mal ehrlich: Wer will schon der Mensch sein, der das eigenhändig gestickte Wandbild (Rahmen: Eiche rustikal, Motiv: röhrender Hirsch) seiner Patentante Gertrud in die Tonne haut – auch wenn es aussieht, wie eine Fusion aus »Es war ein langer Winter« und »Ich hatte schlechte Laune.« Spoiler: ICH!

Zwischen »Ordnung ist das halbe Leben« – und wo, bitte schön, bleibt die andere Hälfte?
Es gibt Tage, da fühle ich mich wie Marie Kondo auf Speed. Da falte ich T-Shirts in geometrischer Präzision, rolle Socken wie Sushi und frage jedes Kleidungsstück, ob es noch »Joy sparkt«. (Bedeutet ‚Freude entfachen‘ und ist ein Kernprinzip von KonMari-Methode)
Manche antworten innerlich mit einem klaren Nein, aber ich falte sie (also die T-Shirts) trotzdem, weil sie teuer waren. Fühle ich mich erleuchtet – oder habe einfach nur zu viel Wäsche angefasst?
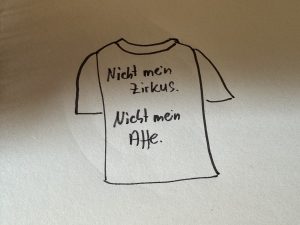
Und dann gibt es diese anderen Tage. Da bin ich eindeutig Team »Man sieht’s ja im Dunkeln nicht, geschweige denn im Schrank«. Licht aus, Tür zu, Problem gelöst – zack, Frieden. Ich nenne das »visuelles Energiemanagement«, klingt nach Nachhaltigkeitsstrategie, ist aber schlicht Faulheit mit Feenstaub.
An solchen Tagen erkläre ich Chaos zur Kunstform: Ein Stuhl voller Bügelwäsche? Das ist keine Unordnung, das ist ein textiles Ökosystem, dass auf noch mehr Wäsche wartet, damti das Bügeln sich lohnt. Die drei Wasserflaschen auf dem Nachttisch? Eine Plastikinstallation zur Vermeidung nächtlichen Dehydrierens. Und die Wollmäuse unterm Sofa? Ich nenne sie »Fred« und »Gudrun«. Die wohnen da jetzt.
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen – zwischen Perfektionismus und »passt schon«. Ordnung ist nicht die halbe Miete, aber definitiv die Kaution fürs seelische Gleichgewicht. Denn wer schon einmal barfuß auf einen Legostein getreten ist, weiß: innere Ruhe ist oft nur ein aufgeräumtes Wohnzimmer entfernt.
Die Sache mit dem Loslassen (ohne Schubladenpsychologie)
Loslassen klingt immer so einfach. In der Theorie. In der Praxis fühlt es sich an, als würde man einem alten Kuscheltier erklären, dass es jetzt bitte emotional eigenständig werden soll.
Denn Loslassen heißt nicht, einfach alles wegzuwerfen – obwohl das bei bestimmten Dingen vielleicht ratsam wäre (Stichwort: Tupperdosen ohne Deckel, Kassenzettel aus 2017, die aus irgendeinem Grund noch »wichtig« sind). Loslassen heißt: ehrlich zu sich selbst sein. Also diese fiesen, kleinen Fragen zu stellen, die man eigentlich nicht hören will:
- Brauche ich das wirklich – oder brauche ich nur das gute Gefühl, es zu besitzen?
- Erzählt dieses Ding noch eine Geschichte – oder erzähle ich sie mir, damit ich es behalten darf?
- Und wenn ich es morgen nicht mehr hätte – würde ich es überhaupt merken?
Ein Tipp, der wirklich hilft (und nicht klingt wie aus einem Ratgeber mit pastellfarbenem Einband und Lavendelduft): Mach ein Foto als emotionalen Platzhalter – Erinnerung ohne Staubfänger, Sentimentalität ohne Stauballergie. Es nimmt keinen Platz weg, du musst es nicht abstauben, und du kannst es theoretisch in der Cloud verstauen – neben den restlichen 8.000 Fotos, von denen du die Hälfte nie wieder anschauen wirst.
Denn Loslassen ist keine Vernichtung – es ist eine kleine Verhandlung zwischen Herz und Verstand. Der eine sagt: »Aber das war mal wichtig!« Der andere sagt: »Ja, aber es steht seit 2013 hinter dem Buchregal.« Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit – wahrscheinlich unter einem Stapel alter Zeitschriften.

Witzige Wahrheiten aus dem Alltag des Aufräumens
Aufräumen ist wie eine harmlose Idee, die völlig eskaliert. Man fängt unschuldig an – »Ich mach nur kurz die Schublade« – und drei Stunden später sitzt man auf dem Boden zwischen alten Konzerttickets, Tupperdeckeln ohne passende Dose und einer existenziellen Sinnkrise.
Zum Beispiel:
- Du räumst deine Küchenschublade auf – und findest fünf Korkenzieher. Fünf! Obwohl du seit Jahren nur Schraubverschluss-Wein trinkst. (Einer davon ist sogar elektrisch. Warum?)
- Du willst »nur kurz« deine Bücher sortieren – und liest dich dann drei Stunden lang durch alte Tagebucheinträge, in denen du 2011 offenbar fest davon überzeugt warst, bald einen Roman zu schreiben.
- Du öffnest eine alte Kiste und findest eine alte CD mit der Aufschrift «Liesels Lieblingshits«– und zack: du suchst im Keller nach einem CD-Player, der doch irgendwo bei den ausrangierten Elektrogeräten sein müsste.
Und dann sind da die wirklich gefährlichen Fundstücke: Der Schal, der »noch total gut ist, wenn man mal auf den Weihnachtsmarkt geht«. (Spoiler: ist er nicht, er kratzt immer noch!). Den Folianten »Chronik es 20ten Jahrhunderts«. Schwer wie ein durchschnittlicher Jungbulle und maximal zweimal aufgeschlagen – um genau was nachzulesen?? Und natürlich: der dubiose Karton, in dem das gesamte Universum auf 40x30x20 cm komprimiert existiert.
Aufräumen ist nie nur physisch. Es ist eine Zeitreise mit Staubwedel, eine Mischung aus Archäologie und Selbstreflexion, bei der man sich fragt: »Wer war ich, als ich dachte, Glitzerlack wäre eine gute Idee?«

Und am Ende sitzt man da, inmitten von Dingen, Erinnerungen und leichtem Muskelkater – und weiß: Ordnung entsteht nicht, wenn man alles findet. Sondern, wenn man endlich nicht mehr alles sucht.
Aufräumen für Fortgeschrittene: Das »Tante-Gertrud-Prinzip«
Wenn du dich von einem Ding nicht trennen kannst, frag dich:
Würde ich es behalten, wenn Tante Gertrud nicht käme?
Wenn die Antwort »nein« ist – ab in den Keller – oder besser gleich ab in die Tonne.
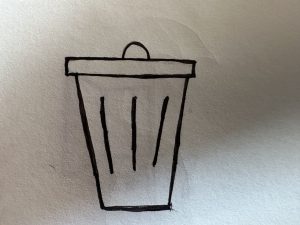
Denn der Keller entpuppt sich in den meisten Fällen als Quarantänezone für sentimentale Entscheidungen. Wenn du es aber partout nicht loslassen kannst – mach Frieden. Nicht alles muss minimalistisch sein.
Denn manchmal ist das Leben einfach zu kurz, um sich von allem zu trennen. Und manche Dinge – so absurd sie sind – sind wie Bekannte oder Verwandte, die zwar nerven, aber irgendwie dazugehören.
Fazit: Weniger Zeug, mehr Luft

Am Ende geht’s beim Aufräumen gar nicht darum, leere Flächen zu schaffen. Es geht darum, Raum für sich selbst zu schaffen. Für Gedanken, Ideen, Langeweile, Stille.
Also: Wenn du das nächste Mal durchs Wohnzimmer schaust und dich fragst, ob du aufräumen solltest – vielleicht reicht’s, nur die Decke vom Sofa zusammenzulegen oder die leere Chipstüte gleich mit in die Küche zu nehmen. Also keine Leerfahrten mehr unternehmen. Oder eben das Licht ausmachen.
Aufräumen ist kein Wettbewerb. Es ist kein Rennen, wer die glänzendste Küche oder den makellosesten Schrank hat. Es ist eher wie Kopf-Yoga mit Staubwedel: manchmal anstrengend, manchmal frustrierend aber manchmal herrlich meditativ.


Stifte gespitzt – Segel gesetzt. Ich bin Kerstin Steinkamp – Bloggerin und Zumba-Instruktorin mit Herz, Humor und einer Portion Gelassenheit. Sprache ist mein Handwerkszeug, Bewegung mein Ausgleich – beides steht für Energie, Leichtigkeit und Klarheit. Ich schreibe für Menschen, die wie ich sich selbst nicht zu ernst nehmen – denn manchmal ist das Leben hart genug. Auf meinem Blog verbinde ich ehrliche Einblicke in meinen aus Alltag, Themen, die mich gerade interessieren und meine Kreativität. Mehr über mich findest du hier.

2 Kommentare